Die Teilwertabschreibung stellt im Rahmen des handels- und steuerrechtlichen Rechnungswesens ein zentrales Instrument zur Abbildung von dauerhaften Wertminderungen von Vermögensgegenständen dar. Sie ermöglicht es, den Fortführungswert eines Wirtschaftsguts unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realisierungsmöglichkeiten sachgerecht zu korrigieren. Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Bilanzbuchhalter ist die exakte Anwendung der Teilwertabschreibung von hoher Bedeutung, da sie unmittelbar die Gewinnermittlung, Steuerbemessungsgrundlagen und Bilanzansätze beeinflusst. In diesem Beitrag werden die rechtlichen Grundlagen, Anwendungsbereiche und praxisrelevanten Fallstricke der Teilwertabschreibung detailliert erläutert.
Ergänzend dazu werden im nachstehenden Video die Voraussetzungen einer Teilwertabschreibung erläutert:
Allgemeines zur Teilwertabschreibung
Von einer Teilwertabschreibung wird dann gesprochen, wenn Wertminderungen des Betriebsvermögens erfolgswirksam erfasst werden sollen, die beim abnutzbaren Anlagevermögen nicht bereits durch Absetzung für Abnutzung (AfA) bzw. Absetzung für Substanzverringerung (AfS) oder durch eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung (AfaA) Berücksichtigung gefunden haben.
Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG kann der Steuerpflichtige von einer Teilwertabschreibung Gebrauch machen, wenn die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist. Dies gilt steuerlich sowohl für das Anlage – als auch für das Umlaufvermögen. Eine dauernde Wertminderung ist ein nachhaltiges Absinken unter den maßgeblichen Buchwert. Eine nur vorübergehende Wertminderung genügt für eine Teilwertabschreibung nicht. Von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens kann dann gesprochen werden, wenn die Abwertungsgründe auch noch bis zum geplanten Verbrauch bzw. bis zur erwarteten Veräußerung, allenfalls bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung anhalten (BMF v. 2.9.2016, BStBl I 2016, 995, Tz. 16).
Aus Sicht eines sorgfältig und gewissenhaft agierenden Kaufmanns müssen nach den Verhältnissen zum Bilanzstichtag mehr Gründe für als gegen eine Nachhaltigkeit der Wertminderung sprechen (BFH v. 21.9.2011 – I R 89/10, BStBl II 2014, 612). Die Prognoseentscheidung muss aus der Perspektive des jeweiligen Abschlussstichtages erfolgen und hat sich an den tatsächlichen (objektiven) Verhältnissen zum Bilanzstichtag zu orientieren.
Teilwertabschreibung bei Darlehensforderungen:
Eine Teilwertabschreibung ist insbesondere zulässig, soweit eine Forderung nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag wegen mangelhafter Bonität des Schuldners voraussichtlich nicht einbringlich ist (voraussichtlich dauernde Wertminderung).
Teilwertabschreibung und außerbilanzielle Korrekturen
Bei einer Teilwertabschreibung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder von Darlehensforderungen an Körperschaften mit einer Beteiligung von mindestens 25 % sind besondere Vorgaben zu berücksichtigen. § 8b Abs. 3 KStG regelt die körperschaftsteuerliche Behandlung von Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den Bezügen i. S. d. § 8b Abs. 1 oder den Anteilen i. S. d. § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG entstehen. Nach § 8b Abs. 3 S. 1 KStG gelten 5 % als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Dies bezieht sich auf die nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei gestellten Veräußerungsgewinne. § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG schreibt vor, dass „Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den in Absatz 2 genannten Anteil entstehen”, bei der Ermittlung des Einkommens nicht zu berücksichtigen sind.
Nach § 3c Abs. 2 EStG wirkt sich auch bei Personenunternehmen eine Teilwertabschreibung nur zu 60 % aus.
Damit ist eine Teilwertabschreibung in folgendem Umfang auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und auf Darlehensforderungen an Körperschaften mit einer Beteiligung von mindestens 25 % in vollem Umfang (Kapitalgesellschaften) und zu 40 % (Personenunternehmen) außerbilanziell zu korrigieren.
Sehen Sie sich die besondere Problematik im nachstehenden Video an:
Wertaufholung nach Teilwertabschreibung
Eine Teilwertabschreibung darf nur solange beibehalten werden, wie die voraussichtlich dauernde Wertminderung nachgewiesen werden kann. Wenn eine voraussichtlich dauernde Wertminderung nicht mehr nachgewiesen werden kann, muss eine Wertaufholung erfolgen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG). Die Teilwertabschreibung kann also nur so lange aufrecht gehalten werden, wie eine voraussichtlich dauernde Wertminderung besteht.
Fazit zur Teilwertabschreibung
Die Teilwertabschreibung ist ein unverzichtbares Instrument im Handels- und Steuerrecht, um dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen realistisch abzubilden. Ihre korrekte Anwendung erfordert ein tiefes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, der wirtschaftlichen Beurteilungskriterien sowie der steuerlichen Auswirkungen. Eine Teilwertabschreibung kann u.U. aber auch nachteilig sein, wenn die Teilwertabschreibung außerbilanziell korrigiert wird und eine Wertaufholung unter die Schachtelstrafe des § 8b Abs. 3 S. 1 KStG fällt.
Ich habe mich insbesondere auf die Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften spezialisiert. Hierzu stehe ich Ihnen auch bei Fragen rund um das Thema „Teilwertabschreibung“ deutschlandweit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jetzt unverbindlich.
Alle Beiträge der Kategorie „Gestaltungsberatung“
Kettenschenkung – Steuern sparen über Generationen
Eine Kettenschenkung ermöglicht es Familien, größere Vermögenswerte wie Immobilien oder Bargeld steueroptimiert an die nächste Generation weiterzugeben. Die Freibeträge bei der Schenkungssteuer sind je nach Verwandtschaftsgrad sehr unterschiedlich – und bei direkten Übertragungen schnell ausgeschöpft. Weiterlesen [...]
Erbschaftssteuer umgehen – Legale Wege zur Steueroptimierung
Wer eine Erbschaft erwartet oder selbst Vermögen weitergeben möchte, sollte sich frühzeitig mit den steuerlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Mit der richtigen Strategie lässt sich die Erbschaftssteuer legal minimieren oder sogar vollständig vermeiden. Der folgende Überblick zeigt Weiterlesen [...]
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
Unternehmensstrukturen entwickeln sich kontinuierlich weiter, und mit ihnen die Anforderungen an rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften stellt ein bewährtes Instrument dar, um auf Marktveränderungen zu reagieren und Unternehmensstrukturen zu optimieren. Seit Weiterlesen [...]
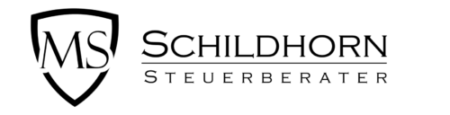



Hinterlasse einen Kommentar