Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung ist ein steuerlich und rechtlich sensibles Konstrukt, das in der Praxis immer häufiger auftritt. Eine grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung kann in verschiedenen Konstellationen vorliegen:
- Wenn der Besitzunternehmer nicht (mehr) unbeschränkt steuerpflichtig ist oder
- wenn eine ausländische Betriebskapitalgesellschaft eine wesentliche Betriebsgrundlage im Inland nutzt
In beiden Fällen spricht man von einer einer grenzüberschreitenden Struktur, bei der sowohl nationale als auch internationale steuerliche Vorschriften zu beachten sind. Dabei ist die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung auch immer im Lichte der Doppelbesteuerungsabkommen zu würdigen. Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung wird im nachfolgenden Beitrag mit Ihren wesentlichen Merkmalen, Risiken und Gestaltungsspielräumen erläutert.
Zum Einführungsvideo Betriebsaufspaltung: Betriebsaufspaltung – Gefahren und Risiken!
Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung: Personelle und sachliche Verflechtung
Eine Betriebsaufspaltung erfordert neben der personellen Verflechtung eine sachliche Verflechtung zwischen Besitz – und Betriebsunternehmen. Die sachliche Verflechtung ist anzunehmen, wenn das Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen eine für dieses Unternehmen wesentliche Betriebsgrundlage zur Verfügung stellt. Eine personelle Verflechtung erfordert einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen sowohl im Besitz – als auch im Betriebsunternehmen. Bei einem nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft organisierten Besitzunternehmen ist ein solcher anzunehmen, wenn die Person (oder die Personengruppe), die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in dem Betriebsunternehmen ihren Willen durchsetzen kann. Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung erfordert gleichermaßen die Voraussetzungen einer personellen und sachlichen Verflechtung.
Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung: Wegzug des Besitzunternehmers
Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung wird auch nicht unterbrochen. Durch den Wegzug des Besitzunternehmers endet die Betriebsaufspaltung nicht. Sie bleibt weiter bestehen, da eine Betriebsaufspaltung auch über die Grenze möglich ist (grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung). Nach dem Wegzug sind für die Besteuerung die Regelungen der beschränkten Steuerpflicht gemäß § 1 Abs. 4 EStG i. V. m. § 49 EStG maßgeblich. Die Einkünfte des Gesellschafters des Besitzunternehmens sind weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb, jedoch ist in der Regel die Betriebsstätte der Betriebsgesellschaft keine Betriebsstätte des Besitzunternehmens. Dass das Grundstück eine die sachliche Verpflichtung begründende wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, ist hierfür irrelevant. Die Vermietungseinkünfte sind daher unter § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG zu subsumieren. Auf abkommensrechtlicher Ebene sind die Einkünfte des Besitzunternehmens hingegen nicht als Unternehmenseinkünfte nach Art. 7 und 13 Abs. 2 OECD-MA einzustufen, (abkommensautonome Auslegung). Das Besteuerungsrecht für die Vermietungseinkünfte obliegt auch abkommensrechtlich dem Belegenheitsstaat (Art. 6 Abs. 1 OECD-MA). Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung in der Form, dass der Besitzunternehmer im Inland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig ist, führt zu beschränkt steuerpflichtigen Vermietungseinkünften. Auch ist die Veräußerung des Grundstücks, welches im Rahmen der grenzüberschreitenden Betriebsaufspaltung gehalten wird, (auch außerhalb der 10-jährigen Spekulationsfrist) steuerpflichtig.
Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung anhand eines plastischen Beispiels
Der S mit ausschließlichem Wohnsitz in Österreich ist Gesellschafter der S-GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in Deutschland. Er vermietet als Eigentümer das Bürogebäude in Deutschland an die S-GmbH. Die laufenden Pachteinkünfte stellen beschränkt steuerpflichtige gewerbliche Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG dar. Abkommensrechtlich ist jedoch Art. 7 DBA AT nicht anzuwenden. Denn auch bei diesen gewerblichen Einkünften schlägt die Vermietungstätigkeit nicht in Unternehmensgewinne um, sondern diese unterliegen Art. 6 DBA AT. Damit hat Deutschland das Besteuerungsrecht an den Mieteinkünften. Ein Veräußerungsgewinn bleibt auch nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerpflichtig nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f) bb) EStG, Art. 13 Abs. 1 DBA AT. Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung unterscheidet sich damit i.d.R. von der rein inländischen Betrachtungsweise durch überlagerndes Abkommensrecht.
Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung: Besteuerung der Anteile (Gewinnausschüttungen und Veräußerungsgewinne)
Ausschüttungen unterliegen der Besteuerung nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a), Abs. 2 EStG. Veräußerungsgewinne- und verluste unterliegen der beschränkten Steuerpflicht gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e) aa) EStG. Mangels inländischer Betriebsstätte unterliegen die Einkünfte des Besitzunternehmens nicht der Gewerbesteuer. Abkommensrechtlich hat der Ansässigkeitsstaat des Besitzunternehmers das konkurrierende Besteuerungsrecht an den Gewinnausschüttungen und das ausschließliche Besteuerungsrecht an den Veräußerungsgewinnen (Ausnahmefälle einer Immobiliengesellschaft als Betriebsunternehmen bleiben unberücksichtigt). Für etwaige Ausschüttungen der GmbH bleibt ein der Höhe nach auf 15 % beschränktes Quellenbesteuerungsrecht gemäß Art. 10 Abs. 2 S. 1 Buchst. b) OECD-MA bestehen.
Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung: Fazit
Die grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung ist keine besondere Form der Betriebsaufspaltung, sondern nur eine grenzüberschreitende Ausprägung. Hier entstehen oftmals steuerliche Problemstellungen, insbesondere im Hinblick auf die inländische Besteuerung. Sollten Sie Fragen zur grenzüberschreitenden Betriebsaufspaltung haben, kontaktieren Sie mich gerne.
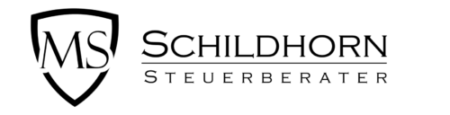

Hinterlasse einen Kommentar